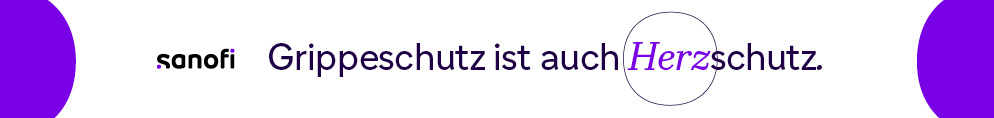11. Basler Hock 2011

Susanne - sanhei55, die Verfasserin des BERICHT´s

KLICK auf das Foto von Helga - Jole47, dann siehst du das VIDEO!



Mulhusium (lat.) Frankreichs – „Manchester des Kontinents“





Tor zum Sundgau – Mülhausen, Mulhouse erst mal 803 urkundlich erwähnt. Geographisch im Dreiländereck. Frankreich, Deutschland und Schweiz, im äußersten Süden des Elsass. Die größte Stadt des Departements und nach Straßburg, die zweitgrößte der Region. Im Zentrum einer mehr als zwei Millionen Einwohner zählenden Region. Mehrere Mal gehört Mulhouse zu Deutschland. Die Schweiz lieferte chemische Farben, worauf sich dann die Basler Chemie gründete.
Auch wir 16 interessierte Feierabend’ler kamen am 19.11.2011 aus allen drei Ländern. Vom Musée L’impression sur Etoffes wurden wir freundlich empfangen von Madam Celine Lachkar. Sie führte uns durch das Haus.








Der Bau einer Mühle gab dem Ort seinen Namen. Ein Mühlrad ziert daher auch das Stadtwappen.
Mülhausen gilt als Wegbereiter der industriellen Revolution in Frankreich. Zunächst entwickelte sich die Textilindustrie, später kamen die Bereiche Chemie und Mechanik hinzu. Das Stoffdruckmuseum beleuchtet die Industrie- und Sozialgeschichte der Stadt. Zu sehen gibt es einfache Maschinen, alte Druckstöcke, Stoffe sowohl aus der Region als auch aus der ganzen Welt. Und immer wieder gibt es Ausstellungen zu besonderen Themen z.Zt. Kinderwelten. Die erste Stoffdruckmanufaktur wurde 1746 gegründet. Die Gründungsväter waren vier junge, wohlhabende Bürger: Henrie Dollfus, Samuel Koechlin, Jean-Jacques Schmalzer und Jean-Jacques Feer. Wohlhabende Familien schickten ihre Söhne zum studieren nach Manchester, England.










1853 wurde die erste Arbeitersiedlung Frankreichs von Henrie Dollfus gebaut „Cité Ouvriére“. Entstanden sind 1.240 Gebäude für ungefähr 10.000 Bewohner. Die Häuser hatten einen Garten und zahlreiche gesellschaftliche Vereine wurden ins Leben gerufen, um das schwere Leben der Arbeiter zu verbessern. Etwa zur gleichen Zeit, gewann die Eisenbahn im Elsass an Bedeutung.


Die Jungunternehmer hatten auch deshalb Erfolg, weil die Baumwolle in Mode kam. Die britische East India Company versorgte Europa mit großen Mengen der Textilfaser aus Indien. Mulhouse unterhält bevorzugte Beziehungen mit Louisiana, von wo Baumwolle importiert wird. Die Baumwolle zeichnet sich im Gegensatz zu Seiden-, Leinen- und Wollstoffen, als sehr leicht und gut bedruckbar aus. Sie wurde für Kleider, Vorhänge, Teppiche usw. verwendet. Farbig bedruckte Baumwollstoffe, die "Indiennes“, hatten im 18. Jahrhundert den Wohlstand von Mulhouse begründet. „Indiennes“ sind ursprünglich mit indisch-exotischen Motiven bedruckter Kattun des 17. bis 19. Jahrhunderts.

Zum Färben und Bedrucken der Baumwollbahnen wurde auf die indischen Techniken zurück gegriffen. Aus Pflanzen wie Krapp-Wurzel, Indigo oder auch aus Schildläusen, gewann man Rot- und Blautöne. Viele verschiedene Techniken wie Bleichen, Drucken, Färben, Walken waren nötig, um auch hohen Ansprüchen zu genügen. In Mulhouse bestellten auch reiche Herrscherhäuser in Europa ihre Stoffe.

Im Museum wird gezeigt, wie das direkte Druckverfahren erfolgt. Eine Druckform, ein z.B. hölzerner Model in den feine Muster geschnitzt sind, wird direkt auf den zuvor gebleichten Stoff gebracht.
Für einen guten Druck, wird das Farbmaterial in einer Wanne vorbereitet. In die Wanne liegt eine Filzmatte, mit einer Bürste wird die Farbe gut verteilt, damit keine Klümpchen entstehen. Das war oft eine Arbeit der Kinder. Das Material für Model ist meist Birnbaumholz. Es ist ein Weichholz ideal zum eingravieren, nicht porös, so dass die Farbe auf der Oberfläche bleibt. Etwa vier bis fünf Mal kann man mit der aufgenommenen Farbe drucken. Orientierungspunkte erleichtern den Musterrapport.
Der Elsässer-Rapport ein Textildesign ist ein Muster das sich senkrecht und waagrecht auf dem Stoff wiederholt. Mit einem Hammer wird auf den Model geschlagen.
Das Stoffdruckmuseum bewahrt in seinen Räumen mehr als zwei Millionen Muster. Eine Quelle der Inspiration für Designer aus aller Welt.

Die Industrialisierung bestimmte den Takt des sozialen Fortschritts und der grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen. Wie in der Ausstellung „Kinderwelten“ im zweiten Stock des Museums gezeigt. Durch die Industriellen Revolution profitierten breite Bevölkerungsschichten und konnten sich somit einen relativen Wohlstand leisten. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde die Phase der Kindheit als ein Defizit angesehen, das schnellstmöglich überwunden werden musste. Dadurch hatte das Kind in der Familie auch nur einen untergeordneten Stellenwert, und wurde nicht als ein eigenständiges Wesen wahrgenommen. Die kurze Phase einer Kindheit war bereits mit etwa sieben Jahren vorbei, dem Alter, in dem die Kinder zu arbeiten begannen. Die Arbeitszeit der Kinder dauerte bis zu 12 Stunden am Tag. Kinder die arbeiteten hatten neben gesundheitlichen Risiken nur eine minimale Schulbildung. Kinderarbeit war an der Tagesordnung. Der Junge lernte Verhaltensweisen und Fähigkeiten durch Imitieren des Vaters und erlernte häufig den väterlichen Beruf. Zudem musste das Kind lernen, sich dem Vater zu unterwerfen, wenn nötig auch mit Gewalt.
Die Familienstruktur der deutschen Mittelschicht erlebte während des 18. Jahrhunderts einen Umbruch, der das heutige Verständnis von Kindheit nachhaltig geprägt hat. Jacques Rousseaus (1712 - 1778) mit der Geschichte von „Emile“ hat einen großen Einfluss genommen.











Eine wichtige Erkenntnis für den Umstellungsprozess in der Kindererziehung war die, dass sich das Kind vom Erwachsenen unterscheidet. Es war nicht mehr ein kleiner Erwachsener, der vieles einfach noch nicht beherrscht, sondern ein Mensch in einer komplett anderen Entwicklungsphase.
Kleinfamilie ging eine räumliche Trennung von Arbeit und Privatleben einher. In der Ausstellung sind die Rollentrennung von Jungen und Mädchen, gut an Hand der Drucke auf den Stoffen zu sehen. Auf Stoff für Jungen werden Zeppelins, Autos und mechanisches Spielzeug gedruckt. Bei den Mädchen sind es Puppen, Tiere, Haushaltsgegenstände.
sagt Rousseau. Das ist ein guter Schlusssatz!!!


Wir haben viel gehört und gesehen, viel gibt es nachzudenken. Es lohnt sich immer wieder ins Museum zu gehen - wir gingen am Ende in ein nettes Café! Ein schöner Abschluss für diesen Tag in einer interessanten Stadt.



Bewertungen und Kommentare
24 Bewertungen
6 Kommentar(e):
Sonnengarten schrieb am 28.11.2011:
Ein wirklich sehr schön ausgearbeiteter und geschriebener Bericht, alle Achtung. Dazu noch das wie immer tolle Video von Helga, einfach Klasse. Grüße aus´em Ländle Ursel
yingyang43 schrieb am 27.11.2011:
Liebe Susanne,das hast Du meisterlich beschrieben.Das war garnicht so leicht,bei diesen vielen Informationen.Super und Danke.Auch das Video von Helga ist einfach schön.Danke Euch Beiden.HanneloreYingyang43
oleander schrieb am 26.11.2011:
Danke liebe Susanne für deine "Halbdoktorabeit" zu diesem Museum. Ich habe sie mit Interesse gelesen. Die Fotos vervollständigen die Perfektion dieses Berichtes. Danke allen Beteiligten. Es war wieder ein Genuß, diesen Bericht zu lesen und das Video von Helga zu betrachten. anke
Ibobibo schrieb am 26.11.2011:
Liebe Susanne, ich bin ein Fan von Mulhouse und insbesondere vom Stoffdruckmuseum. Um so mehr denke ich Dir für Deinen überaus informativen Bericht, insbesondere für die Details aus der Zeitgeschichte. Es war sicher ein spannendes Erlebnis. Liebe Grüße Ingeborg
shanai schrieb am 25.11.2011:
Liebe Susanne, dieser Bericht war schwierig zu schreiben finde ich, was du bestens bewältigt hast. Besonders schwierig ist auch, wenn man nicht alles fotografieren darf und somit das Geschriebene nicht unterlegen kann. Viel Wissenswertes hast du untergebracht, das ich gar nicht mehr in Erinnerung hatte. Nun ja, ehrlich gesagt, wurde es mir zu anstrengend mit der Zeit. Herzlichen Dank für deine Mühe und Bereitschaft, ebenso auch den Fotografen und ganz besonders Helga für das Video! Käthe
Artikel Teilen
Artikel kommentieren