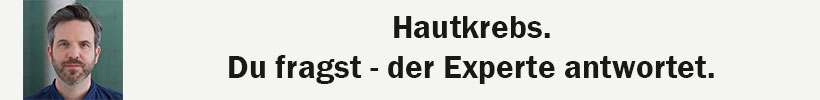Zwei Tage in Gersbach beim 09. Basler Träff / 1. Tag


Zu diesem Thema mehr erfahren zu können, damit hat uns Käthe am 23./24. September 2016 ins Naturfreundehaus Gersbach gelockt. Als Referenten konnte sie zum wiederholten Mal Herrn Werner Störk gewinnen, der uns erneut an seinem reichhaltigen Wissen über die badische Landesgeschichte teilhaben ließ.
Über die Schanzen des „Türkenlouis“ im Schwarzwald und das "legendäre Rheingold" haben wir bei anderen Gelegenheiten von ihm schon viel erfahren.

An diesem Vormittag stellte er uns die Frage:
Glashütten von Hasel und Gersbach zu tun?“
Und erläuterte uns sogleich, dass der Bresse-Saône-Rhône-Graben Teil des Westeuropäischen Riffsystems ist und wie ein Windkanal eine klimatische Verbindung zu Nordafrika, der Sahara herstellt. (Anmerkung der Berichterstatterin: ich kann mir leichter merken, dass der warme Wind, der durch die Burgundische Pforte in unsere Heimatregion einströmt, für das milde Klima sorgt.)
Dieses milde Klima, diese höheren Temperaturen sind die Ursachen, dass hier noch auf 1000 Metern Höhe Buchen wachsen können. Und Buchen, aus denen Pottasche und Holzkohle hergestellt wird, liefern einige der wichtigsten Grundmaterialien zur Herstellung von Glas.

Staunend nahmen wir zur Kenntnis, welcher Raubbau am Wald für die Herstellung von Glas betrieben werden musste. Für die Erzeugung von 1 Tonne Glas werden 250 Tonnen Holz benötigt. Kein Wunder, dass in zeitgenössischen Berichten die Glashütten als „holzfressendes Gewerbe“ bezeichnet werden. Als kleinen historischen Nebenexkurs – und solche Querverbindungen herzustellen, das macht Herr Störk auf ganz besonders launige und kurzweilige Weise - erfuhren wir, dass nicht nur die Glasherstellung den „Wald gefressen“ hat, sondern auch die Eisenverhüttung, der Bergbau, der Schanzenbau, die Köhlerei, der Holzhandel ...


Dieser Raubbau am Wald war auch der Grund dafür, dass die Glasbläser in der Regel nach etwa 30 – 45 Jahren ihre Hütten abbrechen mussten. Sie zerlegten ihre aus Holz gezimmerten Wohnhütten, luden sie auf Karren und zogen an ihren neuen Standort. Der Buchenbestand brauchte dann 150 – 200 Jahre um sich zu erholen und nachzuwachsen. Die Betreiber der Wanderglashütten zerstörten ihre festgemauerten Glasöfen, es sollte nichts mehr an die Glasherstellung erinnern, eine sogenannte Glaswüstung entstand. Vor allem die Glasrezepturen waren ein streng gehütetes Familiengeheimnis. Entsprechend schwierig ist es, die Standorte der ehemaligen Wanderglashütten zu finden, dennoch konnten über 200 bisher im gesamten Schwarzwald nachgewiesen werden, allein acht bei Gersbach.


In den Schwarzwälder Glashütten wurde vom 12. bis zum 17. Jahrhundert Waldglas hergestellt. Es hatte einen waldgrünen Farbton, daher kommt der Name. Diese Farbe entsteht durch den Anteil an Eisenoxid im Quarzsand. Wie man durch eine sogenannte „Glaswäsche“ farbloses Glas, auch „luter Glas“ genannt, herstellen kann, wurde in Venedig herausgefunden und „luteres Glas“ gab es im Schwarzwald erst ab 1500. Venedig hatte noch lange das Monopol auf die Herstellung von reinem Glas.



Alles was uns Herr Störk am Vormittag dieses Tages vortrug, konnten wir, nach einer Mittagspause und einem Spaziergang am Wiesen- und Waldrand hinunter ins Dorf, im „Wald & Glas-Zentrum Gersbach“ betrachten.




Von der Entwicklung der Trinkkultur hatte er gesprochen, hier konnten wir die Objekte sehen. Wer von uns hat schon einmal vom Schaffhauser Becher gehört? Wer von einem Berkemeyer, einem Spechter, einem Krautstrunk“? Und warum haben die historischen Trinkgläser so merkwürdige Aus- oder Einbuchtungen, Noppen aus aufgesetzter Glasschmelze? Wir erfuhren, dass das eine Vorsichtsmaßnahme war, damit das kostbare Glas nicht aus fettigen Händen rutscht.



Im Museum gibt es aber noch viel mehr zu sehen, z.B. große und kleine Schwarzwälder „Guttere“ oder „Gütterli“ = Korbflaschen; oder Glättsteine aus Waldglas, sie wurden auf dem Herd erwärmt, damit man mit ihnen Wäschestücke glätten konnte. Dazu historische Flaschenformen, Glasperlen... Die Vitrinen bergen Schätze.




Das Teilmodell eines historischen Glasofens, über dem „Welle“ zum Feuern aufgeschichtet sind, nimmt einen großen Raum im Museum ein. Auch die Werkzeuge des Glasmachers sind zu sehen. Herr Störk konnte zu allen Exponaten noch Interessantes berichten und wer mehr wissen will, muss das Museum selbst in Augenschein nehmen.




Artikel Teilen
Artikel kommentieren