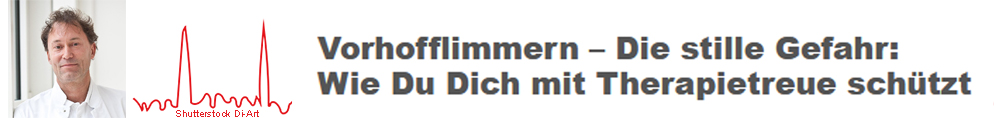Marburg mit Elisabethkirche & Landgrafenschloss
40 Mitglieder der FA-Gruppe FFM-City fuhren am Mittwoch, dem 04.06.2014, um 10:22 ab FFM-Hbf mit dem Hessenticket nach Marburg um sich diese schöne Stadt durch eine Stadtführung mit Elisabethkirche und Landgrafenschloss anzuschauen. Auf der Hinfahrt konnten wir auf Ursel´s "fatina" Geburtstag mit einem Sekt anstoßen. Vor der Führung in der Elisabethkirche stand noch 1,5 Std. Freizeit für einen Kaffee oder einen kleinen Imbiss zur Verfügung, dass auch einige nutzten.

Einige von unserer Gruppe nutzten die Freizeit um in dem Lokal "Gartenlaube" einen Kaffee oder einen kleinen Imbiss zu sich zu nehmen. Hier trafen wir uns auch am Ende der Stadtführung zum Abschlussessen.

Die Elisabethkirche

Die Elisabethkirche ist Marburgs bekanntestes Bauwerk und zugleich ein Besuchermagnet.
Egal ob Pilger, Tourist oder Marburger Bürger - kaum jemand besucht die Elisabethkirche nicht. Dabei wissen zumindest vorher nur wenige, dass es sich eigentlich um eine Marienkirche handelt.
Der Bauherr im 13. Jahrhundert war nämlich der damals sehr mächtige und begüterte Deutsche Orden, der seine Kirchenbauten immer der eigenen Schutzpatronin, der Jungfrau Maria, weihte.
Die zentrale Funktion der Kirche als Grabstätte der Heiligen Elisabeth (1207 - 1231, heilig gesprochen 1235) und als Pilgerkirche über dem Grab der Heiligen überwog jedoch im Bewusstsein der Bevölkerung ihre Funktion als Ordenskirche bei weitem. So setzte sich der Name Elisabethkirche klar durch.
Knapp 50 Jahre dauerte der Kirchenbau (ab 1235, Weihe 1283). Bis zur Vollendung der beiden 80 Meter hohen Türme waren nochmals ungefähr 50 Jahre nötig.

Unsere Stadtführerin Frau Dr. Jacobi erklärte uns vor dem großen Rundgang in der Elisabethkirche einzelheiten über den Bau und die Entstehung.

Wir wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die Zweite Gruppe wurde von Herrn Dr. Pfeiffer geführt. Hier möchte ich mich noch einmal, auch im Namen aller, für die gute Stadtführung bedanken.

Der Sippenaltar
Der Sippenaltar wurde 1511 von Ludwig Juppe für die Altarnische im Elisabethchor gleich neben dem Elisabethmausoleum geschnitzt. 1931 wurde er an seinen jetzigen Platz versetzt.
Den linken Flügel und rechten Flügel hat Johann von der Leyten bemalt. Außen ist die Bemalung fast ganz verwittert. Aber die Innenseiten leuchten in kräftigen Farben. Sie erzählen die Legende von Joachim und Anna den Großeltern Jesu.
Joachim und Anna wollten gerecht sein und die Gebote Gottes erfüllen. Kurz nach ihrer Heirat teilten sie ihren gesamten Besitz in drei Teile: den einen gaben sie dem Tempel und seinen Dienern, den zweiten den Armen und den Pilgern, den dritten behielten sie für sich.

Im nördliche Seitenschiff befindet sich die sogenannte "Französische Elisabethstatue".

Der Marienaltar
Der linke Flügel des Marienaltars zeigt die Anbetung der Heiligen Drei Könige. Zwei sind schon niedergekniet, haben ihre Kronen abgelegt und öffnen ihre Schätze, ein dritter tritt gerade hinzu. Links ist Joseph zu sehen, dahinter die Köpfe von Ochse und Esel, die oft beim Kind in der Krippe dargestellt werden und an das Wort des Propheten Jesaja erinnern: „Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn“.
Der rechte Flügel zeigt den Tod Marias, bei dem sich die Jünger am Sterbebett der Mutter Jesu versammelt haben und ihre Aufnahme in den Himmel, Mariae Himmelfahrt, gefeiert am 15. August. Am Vorabend dieses Festes wurde im Jahre 1235 der Grundstein zur Elisabethkirche gelegt.
Der Schrein zeigt die Krönung Marias durch Gott den Vater und Gott den Sohn. Vielleicht war der Heilige Geist ursprünglich als eine Taube dargestellt, die über Maria schwebte.
Solche Darstellungen des Dreieinigen Gottes waren in der Kirche immer wieder umstritten. Denn sie könnten das Mißverständnis fördern, als seien Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist drei Götter, während gesagt sein soll, daß wir ein und demselben Gott begegnen in der allmächtigen Kraft, die alles im Dasein erhält und lenkt, in Jesus Christus und in der geistigen Kraft, die uns befähigt, um Jesu willen der allmächtigen Kraft in allem zu trauen.
Die Gesichter von Gottvater und Gottsohn sind sich ähnlich. Weil man dem unsichtbaren Gott ein Gesicht nach dem Bild Jesu gab, entsprechend dem Christuswort: „Wer mich sieht, der sieht den Vater.“


Der Schrein der heiligen Elisabeth
Der Schrein der hl. Elisabeth in der nach ihr benannten Kirche in Marburg gehört zu den we-nigen Schreinen des 12. und 13. Jahrhunderts, die nahezu keine Ergänzungen erhalten haben. Das heißt jedoch nicht, dass die Geschichte des Elisabethschreins nicht voll ist von dramatischen Momenten, von grober Vernachlässigung und Verschleppung nach Kassel über Feuersbrunst bis zur zweimaligen Beraubung.
Vermutlich hat das thüringische Landgrafenhaus unmittelbar nach der Heiligsprechung der Landgräfin Elisabeth im Jahre 1235 den Schrein bei einem Goldschmied in Auftrag gegeben, der den Marienschrein im Aachener Münster gekannt haben muss, denn die Architektur des Marburger Schreins ähnelt der des Aachener Marienschreins. Im Unterschied zu fast allen anderen Schreinen besteht er aus einem Langschiff, dem ein Querschiff eingefügt ist, so dass diese beiden Schreine vier Portale besitzen. Die innere Schreinsarchitektur besteht aus Eichenholz, das mit stark vergoldetem Kupferblech umgeben ist.





Der Altar Johannes des Täufers von 1512 erklärt die Geschichte von links nach rechts: Geschichte seiner Geburt; Jesu Taufe durch ihn, sein gewaltsamer Tod; Zerstörung des Grabes und Schändung der Gebeine. Oben Statue Johannes des Täufers und Wandbilder mit Verklärung Christi und Madonna auf der Mondsichel.

Der Elisabethaltar "von Juppe,1513" befindet sich am Ende des südlichen Seitenschiffes.
Der Mittlere Teil, der geschnitzt ist, zeigt von links nach rechts: Aufbahrung Elisabeths, Elisabeth empfängt von Konrad von Marburg die letzte Ölung, die Erhebung ihrer Gebeine im Beisein des Hochadels und Klerus. Die beiden Altarflügel stellen mit Bildern die Geschichte Elisabeths dar. Je 6 Szenen pro Bild. 2 im Vordergrund und vier im Hintergrund. Nähere Informationen und ein reichbebilderter Rundgang durch den Elisabethaltar.

Die Madonna mit Kind (um 1475) befindet sich im Mittelschiff auf der linken Seite am Mittelpfeiler.


Das Elisabeth Hospital
Elisabeth von Thüringen pflegte ab 1228 in ihrem neu gegründeten Hospital in Marburg Kranke und Arme und wurde für ihr wohltätiges Wirken
nach ihrem frühen Tod heiliggesprochen. Über ihrem Grab erbaute der
Deutsche Orden ab 1235 die heutige Elisabethkirche einen der bedeutendsten frühgotischen Bauten in Deutschland. Rund um die Kirche war nach 1234 eine große Niederlassung des Deutschen Ordens entstanden,
von der noch heute einige Gebäude vorhanden sind.



Unsere Stadtführerin stellte die Frage: wie kann man am besten "Kultur erklären" und zeigte dann auf diese Hauswand.

Das Landgrafenschloss
Nachdem wir die Elisabethkirche besucht hatten stand das Landgrafenschloss auf dem Programm.
Hoch über dem Lahntal liegt das Marburger Landgrafenschloß. Seine Baugeschichte reicht bis in das 10. vielleicht sogar 9. Jahrhundert zurück. In seiner langen, wechselvollen Geschichte diente das Schloss als befestigte Wohnburg, Residenz, Garnisionssitz, Gefängnis und Staatsarchiv. Sein heutiges Aussehen verdankt das Schloß zum größten Teil den Ausbauten des 13. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit war Marburg der erste Sitz (Residenz) der Landgrafen von Hessen.




Wer hat denn hier seinen Schuh verloren ??

Diesen herrlichen Blick auf Marburg hatten wir nach einem anstrengenden Aufstieg zum Landgrafenschloss.


Hat dir das Wasser aus dem "Saukopfbrunnen" nicht geschmeckt ??

Auf dem Rückweg vom Landgrafenschloss konnten wir diesen schönen Freisitz bewundern.





Rathaus Marburg
Das Marburger Rathaus, erbaut 1512 bis 1527, ist ein Wahrzeichen der Stadt Marburg. Besondere Beachtung findet zu jeder vollen Stunde der Rathausgockel, der aus luftiger Höhe "hinunterkräht" und dafür sorgt, dass die Video-Kameras gezückt werden.


Alte Universität Marburg
Alt sind sie auf jeden Fall, die Fundamente des 1291 gegründeten Dominikanerklosters, auf denen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts im neugotischen Stil das heute als "Alte Universität" bekannte Gebäude entstand. Und das Wissen wird an diesem Ort seit dem Jahr 1527 intensiv gepflegt. In diesem Jahr gründete der hessische Landgraf Philipp der Großmütige die Marburger Hochschule - die älteste protestantische Universitäts-Neugründung, die bis heute überlebt hat. Das ehemalige Dominikanerkloster bestimmte er zu deren erstem Gebäude.

Zum Abschluss unserer Stadtführung hatte ich im "Stadl" der Gartenlaube einem Familienbetrieb, der seit 1978 besteht, Plätze resreviert.
Ich denke dass das Essen in Ordnung war, wenn nicht wurde es durch die Bedienung und den Chef mit einer "Sonderbeilage" in Ordnung gebracht.
Es ist nicht immer leicht eine so große Gruppe zufrieden zu stellen.



Artikel Teilen
Artikel kommentieren