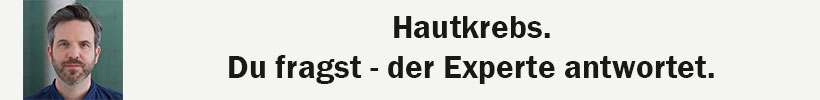Goethe-Haus und Museum
Am Dienstag, dem 28. Oktober 2014, besuchten wir auf Einladung von Gisela "Naheda" das Goethe-Haus und das Goethe-Museum.
Treffpunkt war um 12.30 Uhr vor dem Café Hauptwache am Rossmarkt. Bis zur Führung im Goethe-Haus war noch für eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen Zeit.
Das Elternhaus Goethes im Großen Hirschgraben ist geprägt von der Lebenshaltung des gebildeten Bürgertums jener Zeit.
Dieses kostbare Kleinod lebt durch das elegante Mobiliar, die kupfernen Tiegel über dem wuchtigen Herd, die geräumige Puppenbühne im Dachzimmer, den Bären am Nasenring in der astronomischen Standuhr auf dem Treppenabsatz. Die liebevoll ausgesuchte Innenausstattung des Hauses vermittelt ein Flair von Heiterkeit, Beständigkeit.
In diesem Hause erblickte Johann Wolfgang 1749 das Licht der Welt. Hier verbrachte er bis 1775 weitgehend seine Kindheit und Jugend.


Das Speisezimmer
Das Speisezimmer mit dem reich geschnitzten barocken Spiegel ist in „Bleumourant“, in „ersterbendem Blau“, gehalten, einer Modefarbe der Zeit. Am runden Esstisch ließ Goethe die Reinschrift des „Götz von Berlichingen“ anfertigen. Das Wandbild ist der Rest einer Wachstuchtapete aus dem alten Haus, die nach Goethes Erzählung beim Umbau als Regenschutz über die Kinderbettchen im Dachgeschoss gespannt wurde.
Das Klöppelkissen am Fenster erinnert daran, dass Goethes Mutter gern Spitzen klöppelte. Die Eckvitrine ist mit Porzellan des Rokoko, u.a. aus der Höchster Manufaktur, dekoriert.

Die Küche
In der Küche wirkten eine Köchin und zwei Mägde unter Aufsicht der Frau Rat. Das Besondere ist die original erhaltene Wasserpumpe, die mit einem Brunnen im Keller verbunden ist. In der Regel holte man das Wasser aus einem der zahlreichen öffentlichen Brunnen.
Auf dem Herd wurden die Speisen über Glut oder offenem Feuer auf der Platte zubereitet. Laternen, wie jetzt eine auf dem Küchenschrank steht, mussten in Frankfurt beim Ausgang in der Dunkelheit benutzt werden.

Die barocken Frankfurter Schränke enthielten die Wäschevorräte der Familie, die so groß waren, dass nur dreimal im Jahr Waschtag gehalten werden musste. Die Kupferstiche mit römischen Ansichten gehen auf die Italienreise von Goethes Vater im Jahr 1740 zurück; sie weckten die Sehnsucht des Sohns nach Italien.


Die Astronomische Uhr
Eine besondere Attraktion bildet die astronomische Uhr, die 1746 nach Plänen des Hofrats Wilhelm Friedrich Hüsgen konstruiert wurde. Der junge Goethe durfte sie in dessen Haus bewundern. Umlaufende Ringe oben zeigen das Datum an, darunter kann man die Uhrzeit sowie die Mondphasen und den Sonnenstand mit den Tierkreiszeichen ablesen.
Der Tanzbär im Guckkasten unten hat Signalfunktion: Bevor das komplizierte Werk zum Stillstand kommt, legt er sich auf den Rücken und mahnt, dass die Uhr aufgezogen werden muss.


Johann Caspar Goethe sammelte Gemälde von Frankfurter Malern seiner Zeit, die in der Tradition der Niederländer standen (Trautmann, Schütz d.Ä., Juncker, Hirt, Nothnagel, Morgenstern), sowie von dem Darmstädter Hofmaler Seekatz. Einheitlich schwarz-golden gerahmt, bedecken die Bilder in symmetrischer Anordnung die Wände, wie Goethe es in "Dichtung und Wahrheit" beschreibt.

In der Wäschepresse wurden gefaltete Leintücher zwischen den Holzbrettern „geplättet“. Am Kamin lässt sich das Heizsystem erkennen: Die Öfen in den Zimmern wurden vom Vorsaal aus bedient. Die Kartusche mit der Stadtansicht und dem Porträt Kaiser Josephs II. ist ein Andenken an die Frankfurter Krönungsfeier, die Goethe 1764 miterlebte.

Das Dichterzimmer
Dies war das Reich Goethes. Hier entstanden – vorzugsweise am Stehpult – seine frühen Werke: Gedichte, Dramen ("Götz", "Clavigo", die erste Fassung des "Faust"), Singspiele, Satiren, der Roman "Die Leiden des jungen Werthers" und vieles mehr. Die Silhouette von Charlotte Buff aus Wetzlar neben der Tür vergegenwärtigt das Urbild von Werthers "Lotte".
Weitere Schattenrisse zeigen Freunde, darunter die Brüder Stolberg und ihre Schwester Auguste. Die Gipsabgüsse des Laokoon und einer Niobide bezeugen Goethes Interesse an der Antike. Handzeichnungen von ihm schmücken die Wände; dazu gehören auch Skizzen seines Zimmers und ein Porträt der Schwester Cornelia auf einem Korrekturbogen des "Götz".

Puppentheater-Zimmer
Im Zentrum des Zimmers steht das Gehäuse des Puppenspiels, das durch Goethes Schilderung in dem Roman "Wilhelm Meisters theatralische Sendung" berühmt wurde. Es ist ein Geschenk an den vierjährigen Johann Wolfgang, das ihn schon früh zu phantasievollen und schöpferischen Spielen anregte. Seit 1887 Leihgabe des Historischen Museums Frankfurt a. M.

Für den Abschluss des Tages hatte Gisela "Naheda" für uns im Geburtshaus von Frau Rat, Goethes Mutter Catharina Elisabeth, Nähe Konstabler Wache, dem heutigen gepflegten Ristorante Rustico, Plätze reserviert.
Hier möchte ich mich nochmal im Namen Aller die dabei waren bei Gisela bedanken.


Artikel Teilen
Artikel kommentieren