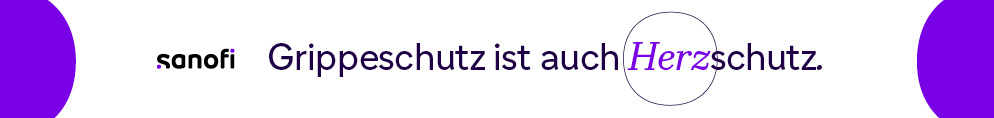Verborgene Seiten von Mainz
Kaum hatten wir von der neuen Stadtführung des bekannten Mainzer Stadtführers Helmut Lehr Wind bekommen, setzte Margret551 sich mit ihm in Verbindung. Am 30. Juli sollten wir einige dieser verborgenen Winkel unserer Vaterstadt kennenlernen.

Wohl keiner von uns wußte, daß es in Mainz eine Schlaraffenburg gibt, in der der Männerbund Schlaraffia Aurea Moguntia sein „Reych“ hat. Aber genau an dieser Burg begann Helmut Lehr mit seiner Führung.
Um 15 Uhr hatten sich 25 Mitglieder und Gäste an der Heunensäule auf dem Marktplatz getroffen. Herr Lehr beorderte uns jedoch zum Heilig Geist – dem historischen Hospital in der Mailandsgasse, das heute einen Gastronomiebetrieb mit historischem Flair beheimatet. Aber eben nicht nur diesen.

Foto: Margret551
Die ehemalige Hauskapelle dient den 85 Mitgliedern der Schlaraffia Moguntia als Versammlungsraum. An der Pforte begrüßt uns nicht nur Helmut Lehr, sondern auch der 1. Vorsitzende Henner Gräff, gebürtig in Koblenz, seit 44 Jahren den Schlaraffen zugehörig. Nach einem Blick auf die Historie des Gebäudes – hier nachzulesen - einem, so Henner Gräff, der bedeutendsten weltlichen Gebäude in Mainz öffnet sich die Tür zum Schlaraffenreich.
Staunend steigen wir am eingebauten Treppenlift nach oben. In der Apsis mit romanischem Triumphbogen und gotischen Fenstern thront, so erläutert uns Henner Gräff, bei den „Sippungsabenden“ die „Herrlichkeit“. Wir dürfen in dem im Stil eines mittelalterlichen Rittersaales ausgestatteten Raum an den Tischen Platz nehmen und erhalten einen Einblick in die Geschichte der Schlaraffen, die hier ausführlich nachzulesen ist.

Foto: Margret551

Henner Gräff erklärt uns, dass die Schlaraffen ein weltweit verbreiteter Männerbund ist, deren Ziel die Pflege von Kunst, Freundschaft und Humor ist. Die Frauen (Burgfrauen) werden geachtet und im Sommer auch in viele Aktivitäten einbezogen. An den Winterabenden (bei den Schlaraffen „Winterung“ genannt) vom 1. Oktober bis 30. April finden in Mainz donnerstags die „Sippungen“ statt, in denen sich ausschließlich Männer treffen, und die nach einem festgelegten Zeremoniell ablaufen. Ausgeklammert werden Politik, Religion und - so Henner Gräff - Zoten.
Die Schlaraffia wurde 1859 in Prag gegründet.
Die Sprache in den weltweit 270 Reychen ist deutsch. In Deutschland gibt es 150 aktive Reyche, darunter welche in den Nachbarstädten Wiesbaden (Wiesbadensia), Ingelheim (Aula Regia), Darmstadt (Tarimundis). Weltweit gibt es über 12.000 Schlaraffen. Für Außenstehende sind sie außerhalb ihrer Sippungen an der „Rolandnadel“, einer kleinen weißen Perle, die am linken Revers getragen wird, zu erkennen oder an einem am Fahrzeug befestigten Aufkleber, der einen blinzelnden Uhu zeigt.

Foto: Knuddeline56
Der Uhu, das Wappentier als Vogel der Weisheit, findet sich mehrfach in jeder Burg, teils stehend, teils an den Wänden, genauso wie die vielen Wappen die die Namen der Ritter tragen. Den erstaunten Mitgliedern erläutert Henner Gräff den Ablauf eines Sippungsabends, in denen die „Sassen“ (Mitglieder) in der 3. Person angeredet werden (Ihr und Euch) und in denen es eine eigene Sprache, das sog. Schlaraffenlatein, gibt. Der schlaraffische Gruß lautet: „Lulu“, das vom lateinischen „Ludum ludite“ (Spielt das Spiel) abgeleitet ist. Es dient auch der Zustimmung und des Lobes, während die Buchstabenumkehr „Ulul“ eine Ablehnung oder Tadel bedeutet.
Neue Mitglieder müssen durch einen Schlaraffen-Ritter als „Pilger“ eingeführt werden und eine Prüflingszeit absolvieren, ehe sie durch allgemeine Abstimmung durch „Kugelung“ (mit schwarzen = Ablehnung und weißen Kugeln (= Zustimmung) aufgenommen werden und als Knappe ihre Laufbahn beginnen, die über den Junker zum Ritter führt.

Foto: Margret551
Geduldig beantwortet der 1. Vorsitzende unsere weiteren Fragen:
Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft beträgt 250 €, der Altersdurchschnitt ist 64 Jahre, es gibt auch einen profanen Verein, die Schlaraffia Moguntia e.V.
Nach einer Dreiviertelstunde drängt Helmut Lehr zum Aufbruch, weitere verborgene Seiten von Mainz warten auf uns.

Foto: Knuddeline56

Schnellen Schrittes gehen wir in die Gymnasiumstraße 7, wo sich das Kloster der Klarissen-Kapuzinerinnen von der Ewigen Anbetung befindet. Es wurde 1860 als erstes kontemplatives Kloster im Bistum als Mainzer Anbetungskloster „Maria Hilf“ gegründet.
Schwester Franziska, eine noch relativ junge Nonne, begrüßt uns im Garten. Er wurde anläßlich des 150jährigen Klosterjubiläums im letzten Jahr neu angelegt, nachdem das Geröll von dem im Krieg völlig zerstörten Kloster beseitigt werden konnte. Die Stadt Mainz stellte ihre Arbeiter zur Verfügung, die vier Wochen lang nur Geröll abfuhren. Danach konnte der Garten angelegt werden. Er bildet die Form eines Kreuzes mit einem Prozessionsweg, der zur Kapelle führt und durch Bänke an den vier Ecken zur Meditation einlädt. Im kommenden Jahr, so hoffen die Klosterschwestern, wird auch der ersehnte Brunnen in der Mitte des Gartens seinen Platz finden können.

Foto: Margret551
Auf dem Weg stehend, erklärt uns Sr. Franziska, daß die Nonnen die tägliche Ewige Anbetung pflegen und ihre Hauptaufgabe im stellvertretenden Gebet und im Angebot der geistlichen Begleitung sehen. Sie beten das Stundengebet und laden dazu auch Gläubige ein. Ihren Lebensunterhalt verdienten sie sich bis vor kurzem durch Hostienbacken. Heute leben sie vom Verkauf selbstgeknüpfter Rosenkränze, die an der Pforte erhältlich sind und von Spenden. Gebet und Liturgie prägen den Rhythmus des Tages.
Die Klarissen-Kapuzinerinnen von der Ewigen Anbetung wurden 1860 von dem Kapuzinerpater Bonifatius Söngen gegründet. Die Nonnen leben nach der Regel der heiligen Klara von Assisi. Das Mainzer Kloster „Maria Hilf“ wurde im gleichen Jahr, also 1860, durch den Mainzer Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler gegründet. Es wurde bei den Luftangriffen auf Mainz im Zweiten Weltkrieg am 27. Februar 1945 schwer getroffen und völlig zerstört. 41 Schwestern, die in den Keller geflohen waren, wurden verschüttet und erstickten. 1952 wurde der erste Gottesdienst im wieder aufgebauten Kloster gefeiert. 1996 folgte die Einweihung der neuen Klosterkapelle St. Klara.
Früher lebten die Nonnen sehr zurückgezogen, so erklärt uns Sr. Franziska – die Klosterschwestern waren in der Öffentlichkeit nicht zu sehen. Im Laufe der Zeit wurde die Öffnung nach außen vollzogen. Heute feiern die Nonnen den Gottesdienst zusammen mit den Gläubigen. Im Kloster leben heute nur noch 10 Schwestern, vor dem Krieg waren es 50.

Foto: knuddeline56
Anschließend steigen wir die ausgetretenen Stufen in den jahrhundertealten Keller, in dem 1945 die Schwestern und Passanten Zuflucht gesucht haben. Er diente damals als Luftschutzkeller. In dem kargen, mit einem kleinen Altar, Kreuz und ewigem Licht ausgestatten Gewölbe, erzählt uns Sr. Franziska, was sich in der Nacht des 27. Februar während des Angriffs auf Mainz im Keller zugetragen hat.

Foto: Margret551
Neun alte Schwestern, die die Stufen nicht mehr hinabsteigen konnten, waren, als sich die Angriffe auf Mainz häuften, evakuiert worden. Beim Bombenangriff waren die anderen alle im Keller – der Boden schwankte. Als der Angriff vorüber war, stiegen die Nonnen mit der Oberin nach oben und sahen das Kloster brennen. Drei Schwestern sind nach draußen gelaufen auf die Straße, die anderen gingen auf Geheiß der Oberin wieder zurück in den Keller. Durch Schutt und Geröll ließ sich später die Tür nicht mehr öffnen. 41 Schwestern erstickten, sie wurden am nächsten Tag knieend vor dem Altar gefunden, versorgt mit der heiligen Kommunion. Eine einzige Kerze auf dem Altar brannte noch.
Die ergreifende Schilderung der Ereignisse läßt uns verstummen.

Zum Abschluss besuchen wir die neue Klosterkapelle, an deren Eingang die Geschichte und ein Gedenkstein, zusammen mit dem ewigen Licht, an die verstorbenen Schwestern erinnert.

Zurück in der Gegenwart, führt uns Helmut Lehr in die Altstadt, wo wir mit ihm in die Geschichte des Baders von Mainz eintauchen. Am Hopfengarten betreten wir den Platz mit den überdimensionalen Badezubern, der als Spielplatz dient.

Foto: Margret551

Foto: knuddeline56
Die Bader galten damals als unehrenhaft wie die Henker und Schinder, das Badhaus zur Hälfte als Heilstätte, zur Hälfte als Hurenhaus. Hier werden Feste „ausgebadet“, hier werden Zähne gezogen, Knochen geflickt. Die Badestuben boten das an, was man heute in Gesundheits- und Wellness-Center geboten bekommt. Hier konnte gebadet, gespeist und medizinisch betreut werden. Die Bader verwendeten schon früh Heilkräuter und versorgten Wunden. Ihr Wissen gaben sie von Generation zu Generation weiter. Der letzte Bader war im 17. Jahrhundert in Mainz ansässig.
Mit der Beschreibung von Helmut Lehr, wie ein „sinnlicher“ Badetag im Mittelalter ablief, versetzt er uns um Jahrhunderte zurück.

Foto: knuddeline56
Schließlich macht er uns noch auf Symbole aufmerksam, die unmittelbar auch mit der Heilkunst zu tun haben, und die über den Platz verteilt sind. Sie zeigen Tierkreiszeichen, Himmelskörper und Elemente. Auf sieben Bronzetafel werden verschiedene Heilpflanzen erklärt, die zum Teil auch auf dem Platz wachsen, u.a. Lavendel, Majoran, Salbei, Zitronenmelisse und Königkerze.

Foto: knuddeline56
Nach der Erkundung zumindest einiger der „verborgenen Seiten von Mainz“ gehen wir zum Abschluss in der Karthäuserstraße 3 in die Bier- und Weinstube „Zum Goldstein“.
Das Haus ist bereits in der ersten Stadtaufnahme von 1568 belegt. 1747 wird das Anwesen als Brauhaus bezeichnet, hat aber schon vorher zwei Brauern gedient. Anfang der 1860er Jahre wurde der „Goldstein“ von der Aktienbrauerei auf dem Kästrich übernommen und nur noch deren Bier ausgeschenkt. Heute ist die Bierauswahl bayerisch. Ein großer Brand am 10.2.78 und der Durchbruch für die Schönbornstraße veränderten das Gesicht des „Goldstein“ zum heutigen Bild. Auf der erhöhten Freifläche vor dem alten Gebäude spenden große Kastanienbäume Schatten. Hier im idyllischen Biergarten sind Plätze für uns reserviert.

Foto: Margret551
Schon im Mittelalter waren Bier und Wein wegen der oft mit Krankheitserregern verseuchten Brunnen die üblichen Getränke. Und so beherzigten wir auch heute wieder den alten Spruch:
„Was soll ich Wasser trinke un kronk wern, ich trink liewer Bier odder Woi un bleib gesund!“

Die Bilder von knuddeline56 (Marita) kannst Du hier sehen, der Link zu den Fotos von Margret551 (Margret) findest Du hier.
(eingestellt am 1.8.10)
Artikel Teilen
Artikel kommentieren