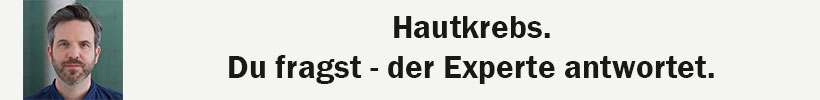Fahrt mit der Moorbahn durch das Grosse Torfmoor am 02.05.2009
Wir erlebten die Moorbahn im Uchter Moor
In meiner Lehrzeit, damals hießen die Leute den Lehrling noch Stift, habe ich in der DIEMA auch solche Lokomotiven gebaut. Heute, nach über 40 Jahren, sehe ich bei der Uchter Moorbahn restaurierte Moorloks im Einsatz. Die hier eingesetzten Loks stammen aber nicht aus der DIEMA, sondern kommen von der SCHÖMA. Zwei Brüder der Familie Schöttler hatten die Maschinenfabriken in Diepholz gegründet und halt Lokomotiven gebaut. Heute existiert nur noch die SCHÖMA.

Diese Lok hat den Namen Essern und verfügt über die Kraft von 44,5 PS aus einem Dreizylinder Deutzmotor. Früher wurde Sie für den Abtransport von Torf aus dem Moor gebraucht und heute zieht Sie Anhänger mit Besuchern durch das Naturschutzgebiet Uchter Moor.

Warum gibt es das Große Moor?
Unsere Weser, der Fluß vor unserer Haustür, hat dazu beigetragen. In der Eiszeit (2400.000 - 180.000 v. Chr.) floß sie einen anderen Weg, weil Sie Gletschern ausweichen mußte. Dabei lagerte die Weser mächtige Schichten von Sand und Kies ab. Aber auch Schluff und Ton wurde abgelagert. Das Material ist eine Art Isolierschicht zum Grundwasser.
Das Oberflächenwasser stand dann darauf und der Prozess begann damit, das sich Torfmoos ansiedelte. Nach einer gewissen Zeit verrottet ein Teil davon und sinkt zu Boden. So bildet sich dann Jahr für Jahr ein Höhenzuwachs von ca. 1 mm Moor. Torfmoos kann bis zum 25 fachen seinen Eigengewichtes an Wasser aufnehmen, deshalb bleibt es im Umfeld immer feucht.
Im Großen Moor entstand so über die Jahrtausende eine Torfschicht mit einer Mächtigkeit von bis zu 6 m.
Ich selbst bin am Rande des Rehdener Geestmoores aufgewachsen und habe das Torfstechen von Hand noch miterlebt. Mitte der 80er Jahre wurde dort der Torfstich beendet und die Fläche wird renatuiert.

Rezeption, Café und Lokschuppen in einem Gebäude
Am 04.05.2007 wurde das Gebäude der Moorbahn Uchter Moor offiziell eingeweiht.
Damit ist diese Attraktion genau so alt wie unser FA Gruppe Schaumburger Land. Grund genug für mich, einmal dort vorstellig zu werden und eine Führung durch das Naturschutzgebiet live miterleben zu können.



Vor uns war eine Gruppe von 80 Besuchern und der erste Teil der Gruppe war gerade zurückgekehrt. Nun wird rangiert und unsere Fahrt wird damit vorbereitet.

Jetzt geht es los und wir starten eine Fahrt ins Moor, die ca. 9,5 km lang ist.

Der Rest der 80 köpfigen Gruppe wartet am Rand des Moores, das wir durchfahren, denn es ist nur 1 Gleis vorhanden. Wir grüßen freundlich und zischen mit 6 - 8 km/h an denen vorrüber.




Wir machen einen Halt und erhalten hier grundsätzliche Informationen über die Entstehung des Moores und bestaunen die Wasseraufnahmefähigkeit des Torfmooses. Bis zum 25-fachen des Eigengewichtes.
Das Wasser im Moor steht, ist nährstoffarm und recht sauer. Neutrales Wasser hat einen ph-Wert von 7,6 - das Wasser hier weist einen ph-Wert von ca. 3,5 auf, ist also deutlich saurer wie eine Zitrone.
Das Torfmoos fühlt sich hier wohl und sorgt somit wieder für das hochwachsen des Moores über die künftigen Jahrtausende. Deshalb wohl auch Hochmoor, würde ich laienhaft sagen.

Wir halten an, verlassen aber nicht unseren Transporter. Das Naturschutzgebiet wird uns erklärt und dann geht es bergauf weiter.

Hier sind wir nun auf dem höchsten Punkt des "Großen Moores" und vor uns liegt ein abgetorftes Gelände, das wieder bewässert wurde.
Im Herbst soll es hier ein großes Naturschauspiel geben, denn es wurden schon bis zu 7.000 Kraniche gezählt, die sich hier auf den Flug in den Süden vorbereiten.
Das kommt natürlich nicht so gut bei den Landwirten an, denn so ein Kranich verfuttert täglich ca. 300 Gramm (vorzugsweise Mais) - und das ca 12 Wochen lang, bis zum Abflug. Also rein rechnerisch mampfen die 7.000 Kraniche so mal eben ca. 180 Tonnen Mais weg. Und um die Menge zu erzeugen benötigt man ca. 90 ha Land - das sind 9.000.000 Quadratmeter.

Unser ehrenamtlicher Führer (Gruppe und auch Lok) hat in der SCHÖMA gearbeitet und in seiner Jugend, genau wie ich auch, an der Herstellung von Diesellokomotiven mitgewirkt. Heute sorgt er bei Melitta dafür, das unsere einzufrierenden Lebensmittel keinen Gefrierbrand kriegen. Er stellt dort unter anderem auch Gefrierbeutel her .

Der Torf wird maschinell gestochen. Dabei ist aber daruf zu achten, das mindesten 60 cm Torfschicht stehen bleiben, weil sonst das Wasser versickert und damit das Moor trockengelegt würde.
Im Jahre 2005 wurde dabei eine Moorleiche entdeckt, die über 2.700 Jahre alt ist. Der Sensationsfund ging durch die Medien und half der Region bei der Umsetzung des Naturschutzprojektes. Wissenschaftlich gesehen war es einer der wichtigsten Funde der letzten 50 jahre.


Den Torf in Haufen zu setzen ist auch heute noch reine Handarbeit und wird überwiegend von Frauen getätigt. Dabei gibt es aber keinen Stundenlohn, sondern, es wird wie früher nach Metern bezahlt.
Ich musste meiner Mutter vor ca. 45 jahren in den Ferien auch beim Torfringeln helfen. Nach drei Wochen war man braungrannt und er Rücken schmerzte tierisch, daran kann ich mich noch lebhaft erinnern.
Für den Abtransport legt man hier Schienen, fährt mit Loren ran und per Bagger wird dann so ein Haufen in jeweils eine Lore geladen.


Geanu so hat unsere Familie noch Jahr für Jahr bis 1968 Torf gestochen und das Brennmaterial für jeweils ein Jahr aus dem Moor geholt.

Als wir uns das hier anschauten, hörten wir einen Kuckuck rufen. Da fiel mir gleich eine Anweisung meiner Oma in der Jugend ein. Wir mussten immer einen Pfennig in der Tasche haben. Denn, wenn man erstmalig im Jahr den Kuckuck hat rufen hören und nichts in der Tasche hatte, dann hatte man übers Jahr auch nicht genügend Geld, so der Volksmund.
Unsere Gruppe hatte Geld im Portemonaie und war natürlich erfreut über den Ruf.
Übrigends war der Kuckuck im Jahre 2008 Vogel des Jahres, weil seine Art als bedroht gilt. Er braucht Lebensräume wie dieses hier im Moor, denn für die Eiablage (in fremde Nester) braucht er Wirtsvögel, wie z.B. Zaunkönig, Neuntöter, Heckenbraunelle, Teich- und Schilfrohrsänger, Bachstelzen, Rotkehlchen.
Und die kommen auch hier wieder verstärkt vor.

Besuch:
Samstag, dem 02.05.2009
Text und Bilder Angelika und Manfred
Links dazu:
Mehr Infos gibt es hier
Regeneration des Großen Torfmoores
Hintergrundinformationen
Artikel Teilen
Artikel kommentieren