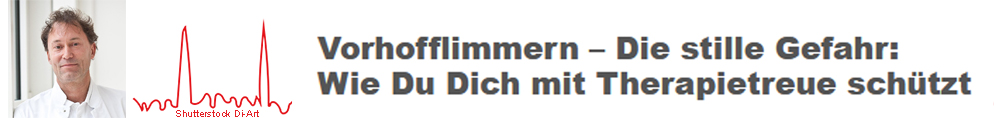09.04.2016 – Stadtführung
in Lauffen am Neckar
Eigentlich wohne ich nur wenige Kilometer von Lauffen entfernt, aber die Sehenswürdigkeiten von Lauffen hatte ich immer noch nicht alle gesehen. Für uns FA-ler wäre das doch auch etwas. Ich kontaktierte mit der FA-Gruppe aus Esslingen, die zeigten auch Interesse also wurde das Ganze unter Veranstaltungen eingesetzt und siehe da wir waren bei der Stadtführung 20 Personen.
10:49 Uhr kam der Zug mit den "Esslingern" an.

Zuerst gab es wie immer eine liebe Begrüßung.

Anschließend fuhren wir zum „Katzenbeißer“, eine nette Weinstube die meiner Schulkameradin und ihrem Mann gehört.

Hier wollten wir zuerst mal Essen damit wir später gestärkt zur Stadtführung konnten.

Sogar 30 Minuten eher begannen wir mit der Stadtführung. Treffpunkt war auf dem Parkplatz Hagdol, gegenüber dem Hölderlinmuseum wo uns Herr Torschmid,der Stadtführer,erwartete.

Herr Torschmid erzählte uns kurz einiges über Lauffen, dass es hier nicht so viel Industrie gibt, dafür aber sehr gute Weine (vor allem Schwarzriesling) angebaut werden,es hier die guten Frühkartoffeln gibt, die Stadt circa 11.000 Einwohner hat, ja und das wichtigste, hier wurde Friedrich Hölderlin geboren.

Jetzt machten wir uns auf den Weg, blieben zuerst an der Seite des Kunstwerkes das von Peter Lenk erschaffen wurde, stehen und wir erfuhren mehr darüber.

Es ist aus Steinguss und erzählt den Lebensweg von Hölderlin, man kann einen „H“ erkennen.

Zu sehen ist Hölderlin als Kind. Das Kind streckt die Arme Schiller entgegen der später sein Vorbild und Förderer war. Hölderlin wurde am 20.03.1770 geboren, verlor mit zwei Jahren seinen Vater, die Mutter heiratete nach zweijähriger Witwenschaft wieder. Die Familie verlässt Lauffen als er vier Jahre alt ist und zieht nach Nürtingen.

Hölderlin als Erwachsener: Hier ist er als tragische Figur mit hängendem Kopf dargestellt. Er musste Schicksalsschläge, mangelnde Anerkennung und Misserfolge zu seiner Lebzeit hinnehmen. Erst später wurde er als größter Dichter deutscher Sprache in der Fachwelt auch vielfach als „der Dichter der Dichter“ überhaupt eingeschätzt.

Schiller und Goethe hier aus einer gemeinsamen Unterpartie hervorwachsen. Sie symbolisieren hier die deutsche Klassik.

Die Figur Diotima erscheint bei Hölderlin in seinem „Hyperion“ (Briefroman) und verschiedenen Gedichten. Er verliebte sich damals in die Bankiersgattin Susettte Gontard, deren Sohn er als Hauslehrer unterrichtete. Die Liebe wurde erwiedert, konnte aber nicht sein mit einer verheirateten Frau (Mutter von 4 Kindern) und unter den Augen des Ehemanns. Er war damals Dienstbote und der Standesunterschied war zu groß.

Nietzsche lebte von 1844-1900 und war einer der Ersten, die das lange Zeit verkannte Dichtergenie Höderlin in seiner Einmaligkeit erkannt hatte.

Herzog Carl Eugen von Württemberg
Über dem ganzen Gebilde steht in großspuriger Haltung und hochmütigem Gesicht Herzog Carl-Eugen auf einem fast verendetem Hirsch, dem Wappentier des Herzogtums Württemberg.
Seine Verschwendungssucht verschlangen unzählige Millionen Volksvermögen. Unbequeme Schriftsteller verfolgte er erbarmungslos. Friedrich Schiller floh damals außer Landes (Mannheim) nach der Aufführung seiner „Räuber“. Auch Hölderlin musste leiden unter Carl Eugens unbarmherzigem Reglement.

Das sind nur ein paar Anmerkungen die ich aus einem Schreiben von Bernhard Plieninger entnommen habe.
Weiter geht es, wir überqueren die Zaber und gehen in den Park zur Hölderlin-Gedenkstätte


Gedenkstätte: Das bronzierte Zinkrelief mit der Büste von Hölderlin war über dem Eingang des ehemaligen Amtshaus der Klosterhofmeister angebracht, Nach Abbruch des Gebäudes wurde es 1923 in einem dafür errichteten Gedenkstätte im Garten angebracht.

Museum und Kloster: Nach 1250 als Dominikanerinnen-Kloster gegründet. Ab 1807 kommt es in Besitz des Konighauses Württemberg als Kameralamt. 1870 Übergang in Privatbesitz, da wurden alle Gebäude bis auf das Geburtshaus Hölderlins abgebaut. 1883 Verkauf an den Landwirt Heinrich Thedens, 1923 Die Klosterkirche wird aus den Grundmauern und noch vorhandenen Steine des Klosters wieder erbaut, unter Verzicht auf den früheren Chor. 1984 wird das Kirchengebäude zum Museum der Stadt Lauffen mit einem extra Hölderlin-Zimmer.

Am Eingang des Museumsgelände sind Spitzbogen mit Maßwerkresten vom früheren Kreuzgang in die Begrenzungsmauer eingelassen.

Wir überqueren die Straße und stehen vor einer ehemaligen Öl- und Sägemühle die bis ins 20. Jahrhundert genutzt wurde.
Gegenüber der Mühle kann man noch die Mahlsteine sehen.

Schaut man über die Straße sieht man rechts oben ein altes, gelblich gestrichenes Haus, das Hölderlin-Haus. Hier wurde Hölderlin geboren.

Die Führung ging weiter in Richtung Rathaus auf der Insel.
Wir „Kränkelnden“ gingen zum Auto, fuhren diese Strecke und warteten auf die „Fußgänger“.
Von der Insel aus konnten wir sehen wie die Gruppe sich näherte.....

.....dann die Treppe runter ans Neckarufer ging.

Die Alte Neckarbrücke:
Zur Römerzeit befand sich dort eine Furt und seit dem frühen Mittelalter konnte man den Neckar mit einer Fähre überqueren. Die steinerne Brücke wurde im Jahre 1474 für Weg-, Brücken- und Floßzoll erbaut. 1529 stürzte die Brücke bei Hochwasser ein, wurde mit 11 Jochen (Brückenbogen) wieder erbaut und war bis 1730 die einzige Neckarbrücke zwischen Cannstatt (Stuttgart) und Heilbronn.1945 sprengten abziehende deutsche Truppen mit Fliegerbomben den mittleren Brückenbogen in die Luft. Heute sind noch 6 von den damals 11 Jochen erhalten. Die Überquerung des Neckarkanals zum „Städtle“ sichert heute eine Stahlkonstruktion.

Am ersten Brückenpfeiler sind auf der Dorfseite die Hochwasser-Markierungen zu sehen......

am zweiten Pfeiler Reste einer steinernen Treppe.

Das Warten hat ein Ende, jetzt kamen schon die Ersten über das Insel-Brückele gelaufen.
Alle da, weiter ging es mit der Führung.

Rathaus mit Rathausgarten
Der Turm und sogenannte „Mantelbau“ wurden im 11. Jahrhundert durch die Grafen von Lauffen errichtet. Später war die Burg der Sitz der württembergischen Vögte und Oberamtsleuten. Sie wurde im Dreißigjährigen Krieg zum größten Teil zerstört. Der westliche Wohnteil wurde 1716 an den Turm neu dazugebaut.1817 hat die Gemeinde Lauffen die Insel käuflich erworben und das Gebäude wird als Rathaus benutzt. Die Einigkeitslinde wurde am 1.April 1914 im Rathausgarten anlässlich der Vereinigung der seitherigen Teilgemeinden „Stadt“ und „Dorf“zu einem Gemeindebezirk, gepflanzt.

Schaut man zurück über das Insel-Brückle sieht man das Stadtbauamt, das nach Abriss 1965 , im gleichen Stil wieder aufgebaut wurde.

Schräg dahinter, die hohen "Kamine", das Zementwerk, wurde am 9.12.1888 gegründet. Standort war Lauffen, da es der südlichste Punkt der seinerzeit auf dem Neckar betriebene Kettenschifffahrt war. Auf dem Wasserweg konnte man über Mannheim die benötigte Kohle hertransportieren und aus dem Steinbruch in Neckarwestheim (heute
der Standort des Kernkraftwerkes GKN) kam der Kalkstein.

Der mit einer Schmalspurbahn zur Verarbeitung herangeschafft wurde. (Die Bahn gibt es heute nicht mehr)

Zurück über das Rathausbrückle ging es weiter „Zur Sonne“. Ein altes Fachwerkhaus das ursprünglich eine Bäckerei mit Wein-Probierstube war.

Noch ein kurzes Stück weiter der Straße entlang und wir sahen das alte Heilbronner Tor. Das vergitterte Fenster über dem Torbogen war das ehemalige Gefängnis.
Auf der gegenüberliegenden Seite der Nordseite steht ein Rundturm mit echteckigem Häuschen. Dieser Bürgerturm trägt den Namen Engelhansen-Turm

Im oberen eckigen Teil befinden sich zwei Arrestzellen, die wurden noch bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts als Ausnüchterungs-Zellen benutzt.
Weiter ging es vor die „Alte Kelter“. Dieser Bau wurde 1568 unter Herzog Christoph von Württemberg als erster Flügel einer dreiflügeligen geplanter Schlossanlage errichtet. Durch seinen Tod wurde die Anlage nicht vollendet. Nach dem Übergang in Privatbesitz wurde das Gebäude saniert und wird teilweise als Gastronomie-Betrieb benutzt.


Die Martinskirche, ursprüngliche Nikolaus-Kapelle war unser nächstes Ziel. Erbaut um 1200 mit Gründung der Stadt Lauffen. Nach der Reformation wurde die Kapelle kaum mehr benutzt. In Kriegszeiten wurde sie als Heu- und Haferschuppen benutzt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde sie Martinskirche genannt. Nach schwerer Beschädigung im Zweiten Weltkrieg wurde das Kirchlein wieder instand gesetzt. 1977/78 bei gründlicher Renovierung wurden im Chor mehrere bemerkenswerte Wandmalereien freigelegt.

So das „Städtle“ wäre besichtigt, jetzt ging es wieder zurück. Über die Brücke zur Regiswindis-Kirche. Die erste Kirche an dieser Stelle wurde in Holzbauweise errichtet und dem Heiligen Martin von Tours geweiht. Erwähnt wurde die Kirche erstmals 741/742 in den frühesten Urkunden unter dem Namen Martinskirche. 1227 begann der Kirchbau der jetzigen Ortsheiligen Regiswindis als dreischiffige Basilika. 1564 durch Blitzschlag brannte die Kirche. Es blieb nur der Chor erhalten. Der Wiederaufbau erfolgte als Hallenkirche, die Decken wurden niedriger gestaltet, der Spitzturm wurde durch einen helmartigen Aufbau mit draufgestellter „Laterne“ ersetzt. An der Nordseite des Chors ist ein Steinerner Schrein zu sehen, hier wurde ab 1521 der später abhandengekommene Silbersarg der Regiswindis aufbewahrt. 5 Gemälde schildern die Legende der Regiswindis in der Kirche.

Regiswindis-Kapelle:
Die Kapelle hat einen oktogonalen Spitzturm und ist eine architektonische Rarität.
Seit März 1882 steht der Sarkophag der Regiswindis in der Kapelle. Der Sarg stand zuvor zwischen Kirche und Kapelle im Freien. Die Inschrift auf dem Steinsarg gibt einen wichtigen Hinweis auf sein Alter und das Alter der Kirche. Im Jahre des Herrn 1227 wurde die Jungfrau und Märtyrerin Sankt Regiswindis kanonisiert und beigesetzt und der Grundstein der Kirche gelegt.
Nach der Besichtigung der Kapelle führte uns Herr Torschmid noch ein Stück in Richtung Bahnhof und verabschiedete sich von uns.
Leider musste die Esslinger-Gruppe gleich weiter zum Bahnhof, konnten sich dort noch einen Kaffee genehmigen bevor ihr Zug heimwärts fuhr.
Ich hoffe es hat allen gefalle und sicher findet sich mal wieder etwas wo wir gemeinsam unternehmen können.
Vielen Dank noch an meine Fotografen für die Fotos.
Gruß Uschi
Artikel Teilen
Artikel kommentieren