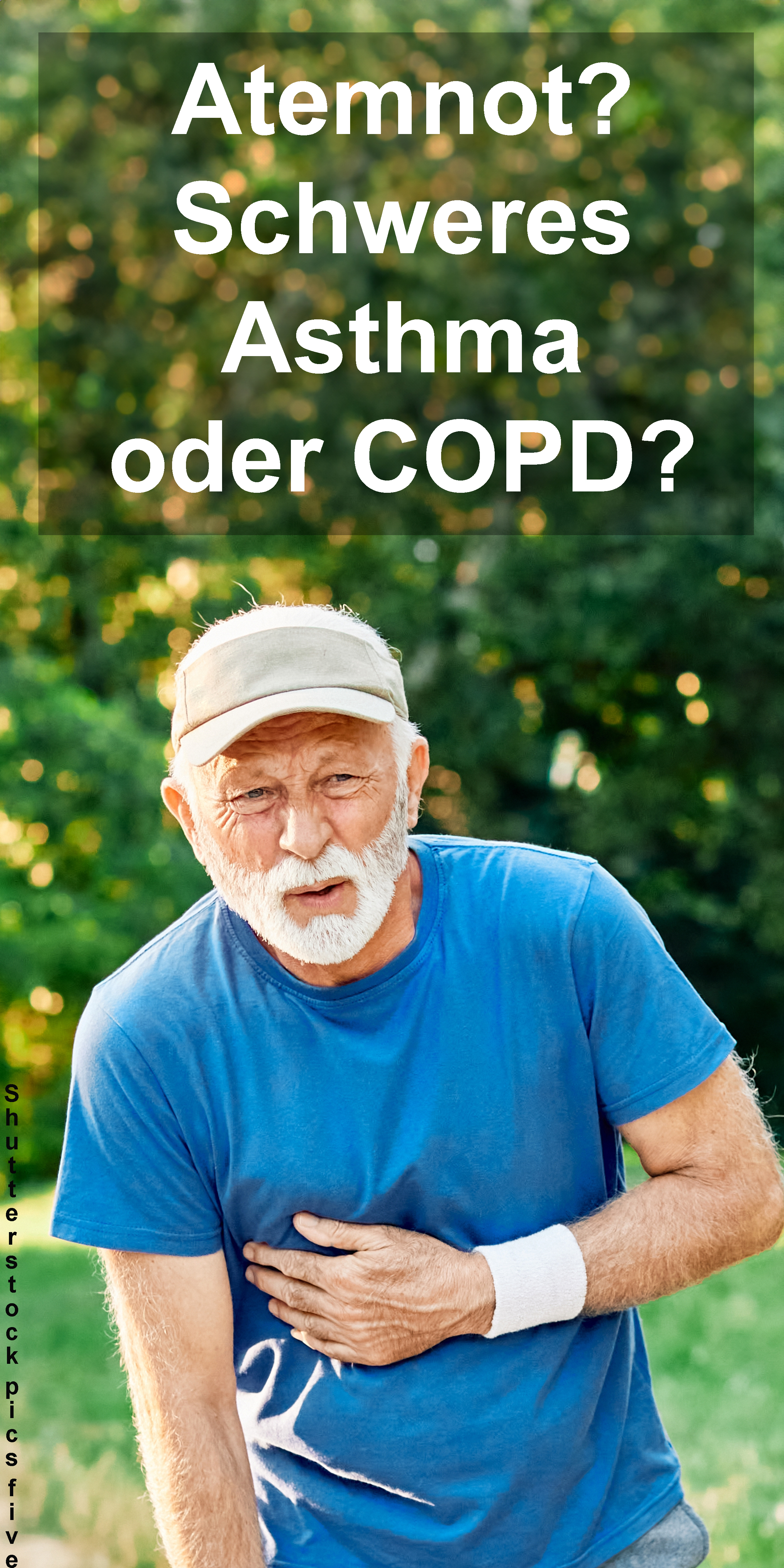So machen Apps süchtig
Geht man durch die Straßen, sieht man sie überall: Menschen, die auf ihre Smartphones schauen. Gefühlt holt jeder, der auch nur einmal kurz warten muss, sein Handy hervor und selbst beim Gespräch im Café ist es manchmal präsent. Tatsächlich beweisen Studien, dass immer mehr Personen Probleme damit haben, ihr Smartphone aus der Hand zu legen und es nicht zu nutzen. Das Perfide daran ist, dass etliche Anbieter ihre Apps genau mit diesem Ziel programmiert haben. Damit der Nutzer so lange und häufig wie möglich ihr Produkt benutzt, bedienen sie sich psychologischer Tricks. Dieses Phänomen wird in der Fachsprache „Stickiness“ genannt, auf Deutsch „Klebrigkeit“.

Angebot ohne Ende
Facebook war eine der ersten Apps, die sich des Mittels der niemals endenen Posts bedient hat. Egal wie weit man scrollt, es werden immer weiter Beiträge und Beiträge und Beiträge angezeigt. Diese Phänomen wird in der Fachsprache „infinite scroll“, also "unendliches Scrollen" genannt.
Wie auch bei Instagram haben sich natürlich irgendwann die Beiträge der abonnierten Personen erschöpft. Das macht aber nichts, denn hier spülen Facebook, Instagram und Co. einfach neue Posts in unser Blickfeld, von denen sie ausgehen, dass sie uns gefallen. Das ist übrigens auch der Grund, warum man von einer „Blase“ spricht, in der man sich auf sozialen Netzwerken bewegt. Da das Ziel die möglichst intensive Nutzung der App ist, wertet der Algorithmus unsere Likes und Lesezeiten sowie die Absprungraten aus. Basierend darauf erhalten wir neue Beiträge, die den von uns bereits gelesenen thematisch ähneln und im Grunde nur Variationen derer sind. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die App nicht geschlossen wird. Youtube agiert mit dem gleichen Prinzip, wenn nach dem Abspielen des Videos automatisch das nächste anfängt.
Einsatz von Glücksspiel-Mechanismen
Eine weitere Methode, welche die Nutzer abhängig machen soll, heißt „pull to refresh“. Das bedeutet so viel wie „Ziehen zum Erneuern“. Gemeint ist damit, dass die Seite neu lädt und man neue Inhalte angezeigt bekommt, wenn man sie kurz mit einem Finger herunterzieht. Was kommen wird und ob es gut ist, weiß man im Vorhinein nicht. Das Prinzip ähnelt dem des einarmigen Banditen. Nach dem Ziehen des Hebels weiß man nicht, was kommt, hofft aber auf Gewinne. Selbst wenn diese Ausbleiben, wird der Hebel immer wieder gezogen – der Gewinn kann ja jederzeit eintreten. Genau dieses psychologische Phänomen machen sich Apps zunutze.
Die Sache mit den Likes

Natürlich freut es uns, wenn das, was wir tun und eben auch posten anderen gefällt. Ein Mittel, um das Gefallen auszudrücken, sind sogenannte „Likes“, also Gefällt-Mir-Angaben. Diese setzen beim Nutzer das auch als Glückhormon bekannte Dopamin frei. Daran ist erst einmal nichts auszusetzen. Problematisch wird es jedoch dann, wenn darüber Druck ausgeübt und das Ganze zu einer Art Währung wird. Instagram und Facebook beispielsweise zeigen an prominenter Stelle die Anzahl der Likes und werten darüber. Wer mehr Likes und Kommentare erhält, wird öfter angezeigt und erhält bessere Platzierungen. Es geht also nicht mehr nur darum, seine Inhalte mit Freunden und Bekannten zu teilen, sondern um eine vermeintliche Messung der Beliebtheit. Besonders anfällig dafür sind Personen mit einem eher geringen Selbstwertgefühl, die darüber Bestätigung erhalten.
„Richtiges“ Verhalten wird belohnt
Ob nach absolvierter Lektion in der Sprachenlern-App, durch das schnellere Erhalten von Leben in einem Spiel beim regelmäßigen Einloggen oder Extrapunkte, wenn man die App Freunden empfiehlt: Apps belohnen von ihnen erwünschtes Verhalten mit kleinen „Aufmerksamkeiten“. Geschenke erhalten schließlich die Freundschaft, nicht? Gleichzeitig wird durch Verlust der Privilegien bestraft, wer sich eben nicht wie gewünscht verhält.
Und nun?
Grundsätzlich sind soziale Medien und Apps etwas Tolles, die eine Chance in vielen Bereichen sein können. Und selbstverständlich geht es auch darum, dass die Nutzung uns glücklich macht. Nur sollte man genau hinschauen, denn bei vielen der genannten Beispiele geht es nur um die Monetarisierung und nicht darum, dem Nutzer ein bestmögliches Erlebnis zu bieten. Wer also sieht, dass er zu viel Zeit mit dem Smartphone verbringt, sollte sich vor Augen führen, was dahinter steckt. Die Entwickler solcher Apps erschweren das Schließen der Anwendungen bewusst, indem sie „fomo“ nutzen. Fomo ist ein Akronym und bedeutet „fear of missing out“, die Angst, etwas zu verpassen. Wer sich das bewusst macht, hat schon einmal einen Vorteil, der es erleichtert, das Handy einfach mal zur Seite zu legen.
Artikel Teilen
Artikel kommentieren